
Wir erforschen grundlegende Umweltprozesse, insbesondere die Zusammenhänge, Wechselwirkungen und Rückkopplungen zwischen Litho-, Pedo-, Hydro- und Biosphäre. Diese Fokussierung entspricht der zentralen Bedeutung geowissenschaftlicher Forschung für zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen und Aufgaben, vor allem hinsichtlich der beschränkten Verfügbarkeit von Georessourcen, der Verantwortung für nachhaltige Entwicklungen, des globalen Wandels und des frühzeitigen Erkennens von Georisiken.
-
AquaDiva
 Schematische Darstellung der Prozesse, die im Rahmen des Projekts untersucht werden sollen. (Entnommen aus dem AquaDiva-Antrag) Foto: Angewandte Geologie
Schematische Darstellung der Prozesse, die im Rahmen des Projekts untersucht werden sollen. (Entnommen aus dem AquaDiva-Antrag) Foto: Angewandte GeologieRückwirkung von geochemischen Störungen und
Medienreaktivität in der kritischen Zone auf die Speziation von Spurenelementen und
Transportparameter (C07)DFG Förderkennzeichen 218627073
Laufzeit: Juli 2021 - Juni 2025
Projektleitung: Prof. Thorsten Schäfer
Bearbeitung: Ruth Ewouame, Dr. Dirk Merten
Koordination: Collaborative Research Centre 1076 AquaDiva.
https://www.aquadiva.uni-jena.de/ en
Beschreibung:
Das Grundwasser macht im Durchschnitt ein Drittel des vom Menschen verbrauchten Süßwassers aus, in einigen Teilen der Welt kann dieser Anteil sogar bis zu 100% erreichen. Trotz ihrer Bedeutung sind Grundwasserleiter durch verschiedene Ereignisse wie Landnutzung und extreme Wetterereignisse
(Starkregen, Schneeschmelze) bedroht, insbesondere durch den Klimawandel. Das Ziel des Sonderforschungsbereichs 1076 AquaDiva ist es daher, die Verbindung zwischen der ober- und unterirdischen Biogeosphäre, der sogenannten Kritischen Zone der Erde zu untersuchen.Die Hauptziele unseres Teilprojekts C07 sind das Verständnis der Dynamik, der Kontrolle und der Rückkopplungen der Fluide auf den Transport und die Speziation von kolloidassoziierten Spurenstoffen von der Oberfläche bis in den Untergrund unter Verwendung von technischen Ton-Nanopartikeln (engineered clay nanoparticles, ECNs) als Tracer und die Untesuchung des Einflusses der lokalen Geologie und klimatischer Ereignisse auf das Mikrobiom im Untergrund an den beiden AquaDiva-Standorten.
-
CONCERT_CCair
Komponentenadditiv-Ansatz zur Vorhersage der Zementpasten-Rheologie unter Berücksichtigung von sekundären zementgebundenen Materialien und deren spezieller Effekt auf die Thixotropie sowie Beton Entlüftungsverhalten
SPP2005 DFG Förderkennzeichen SCHA 1854/7-1
Laufzeit: März 2021 bis 2024
Projektleitung: Prof. Thorsten Schäfer
Bearbeitung: Steffen Hellmann, Frank Heberling, Johannes Lützenkirchen (beide KIT-INE) & Teba Gil Diaz
Schlagwörter: CSH Phasen, kalzinierte Tone, Luftblasen, spICP-MS, AFM, Oberflächenkomplexierungsmodelle
Die Zementindustrie treibt ihre Forschung in Richtung sekundärer zementgebundener Materialien (SCMs) voran, die es ermöglichen, den CO2-Fußabdruck von Beton zu reduzieren. Ziel dieses Projekts ist es, vielversprechende SCM-Alternativen wie kalzinierte Tone (CCs) und Kalksteinpulver (LSP) zu erforschen. Der erste Ansatz besteht darin, das rheologische Verhalten frischer Zementzusatzmittel dieser SCMs während der frühen Stadien der Hydratation im Gießprozess zu untersuchen. Der zweite Ansatz konzentriert sich auf der potenziellen Rolle von SCMs bei der Vermeidung eines unerwünschten Luftblaseneinschlusses vor dem Aushärten des Betons. Experimentelle Ansätze umfassen die Charakterisierung von Partikelwechselwirkungen und Pastenrheologie in Modell- und realen Systemen über eine nationale Zusammenarbeit zwischen FSU, KIT, BUW und LUH.
 Abbildung 1: a) Normierte Kraft-Abstandskurven bei Annäherung der Silica Kolloid-Probe und der Klinkeroberfläche, b) entsprechende Kurven beim Zurückziehen der Silica Kolloid-Probe von der Oberfläche, c) REM-Aufnahme eines mit einem Zementpartikel modifizierten AFM-Cantilevers. Der geschätzte Kontaktbereich ist rot hervorgehoben.
Abbildung 1: a) Normierte Kraft-Abstandskurven bei Annäherung der Silica Kolloid-Probe und der Klinkeroberfläche, b) entsprechende Kurven beim Zurückziehen der Silica Kolloid-Probe von der Oberfläche, c) REM-Aufnahme eines mit einem Zementpartikel modifizierten AFM-Cantilevers. Der geschätzte Kontaktbereich ist rot hervorgehoben. -
EVIDENT
Erosion von Bentonit unter In-situ Bedingungen durch Einwirkung natürlicher Wässer in geologischen Tiefenlagern
BmWi Förderkennzeichen 02 E 12153A
Laufzeit: 01.06.2023 bis 30.05.2026
Projektleitung: Prof. Thorsten Schäfer
Bearbeitung: Léon Frederic Van Overloop
Schlagworte: Bentonit, Multi-Barriere-System, Na-Montmorillonit, akzessorische Minerale, Erosion, Kolloide, CFM-iBET, CFM-LIT, Auswirkung von thermische Belastung
Beschreibung:
Das übergeordnete Ziel des Vorhabens ist es, das mechanistische Verständnis der für die Integrität der geotechnischen Barriere kritischen Prozesse unter naturnahen, endlagerrelevanten Bedingungen in geklüfteten Granitsystemen zu erhöhen und eine belastbare prognostizierende Modellierung der Bentonitbuffers und des kolloidgetragenen Radionuklidtransport zur Verfügung zu stellen.
Die Arbeiten sind in das CFM-Projekt am Grimsel Felslabor eingebettet und bauen zum Teil auf den in Kollorado-e³ (FKZ: 02 E 11759A) erzielten Erkenntnissen auf, betrachten aber auch gänzlich neue Aspekte.
-
FluviMag
Fluviatiler Transport von Magneto-Mineralen
Laufzeit: seit 2011
Projektleitung: Dr. Michael Pirrung
Bearbeitung: Dr. Michael Pirrung
Schlagworte: physikalische Eigenschaften, fluviatile Sedimente
Beschreibung:
Der gesteinsphysikalische Parameter magnetische Suszeptibilität von Liefergesteinen und rezente Ablagerungen in fluviatilen Systemen wird untersucht. Ziel ist ein besseres Vertändnis von Transportdynamik und – bevorzugt in Kombination mit geochemischen Daten – von anthropogener Beeinflussung der Entwässerungssysteme durch z.B. Siedlungen, Bergbauhalden und äolischen Staub.
-
MykoBEst
Einfluss der Mykorrhizosphäre von Bäumen auf die Bodenentwicklung und Erosionsverminderung von Uran-Bergbaufolgelandschaften
BMBF-Förderkonzept FORKAExterner Link 15S9445A-C
Laufzeit: 01.07.2023 – 30.06.2026
Projektleitung:
Prof. Erika Kothe, Prof. Thorsten SchäferBearbeitung: Sarah Nettemann, Caroline Pukallus, Dietrich Berger, Markus Riefenstahl
Schlagworte: Dendroanalyse, Mykorrhiza, Erosion, Phytostabilisierung, Kurzumtriebsplantage, Schwermetalle, Radionuklide
Beschreibung:
Im BMBF-geförderten Verbundprojekt MykoBEst – Einfluss der Mykorrhizosphäre von Bäumen auf die Bodenentwicklung und Erosionsverminderung von Uran-Bergbaufolgelandschaften werden radionuklid- und schwermetallbelastete (RN/SM) Substrate im Sinne einer Strahlenschutz‐Vorsorge zur Produktion von Energiepflanzen genutzt.
-
RENA
Biologische Radionuklidentfernung durch Nutzung natürlicher Assoziationsprozesse
BMBF Förderkennzeichen 02NUK066B
Laufzeit: 01.09.2021 bis 30.08.2024
Projektleitung: Prof. Thorsten Schäfer, Prof. Erika Kothe
Bearbeitung: Ariunzaya Löwe, Dr. Susanne Seidel, Dr. Sarah Hupfer
Schlagworte: Porenraumcharakterisierung, Hydrodynamik, Biodiversität, Transportmodelle
Beschreibung:
Ziel des Verbundprojektes RENA ist die Entwicklung eines Verfahrens zur ex situ-Behandlung radionuklidbelasteter Böden, die aus dem Rückbau kerntechnischer Anlagen stammen. Dafür wird das Potential der Biologie (Pflanzen, Pilze) zur Mobilisierung und Entfernung von Radionukliden aus Böden untersucht.
-
SPIEG3L
Räumlich aufgelöste Spektroskopien zur Identifizierung von Grenzflächenprozessen und Spezies 3 – wertiger Lanthaniden und Actiniden
BMBF Förderung 02NUK089C
Laufzeit: 01.04.2024 – 31.08.2027
Projektleitung: Prof. Thorsten Schäfer
Bearbeitung: Valentin Gabert
Schlagworte: Transporteigenschaften von Radionukliden, korrelative Spektroskopie
Beschreibung:
Im BMBF-geförderten Projekt SPIEG3L - Räumlich aufgelöste Spektroskopien zur Identifizierung von Grenzflächenprozessen und Spezies 3-wertiger Lanthaniden und Actiniden werden die Transporteigenschaften von Radionukliden, welche für die realitätsnahe Modellierung von potenziellen Freisetzungsszenarien relevant sind, untersucht.
-
TRAVARIS
Transfer langlebiger Radionuklide aus der vadosen Zone in die Rhizosphäre und deren Aufnahme in Pflanzen unter Berücksichtigung mikrobiologischer Prozesse - Teilprojekt A: Einfluss von natürlichen nanopartikulären Phasen auf die Radionuklidverteilung im Wirkungsgefüge Boden-Pflanze
PT GRS Förderkennzeichen 15S9437A
Laufzeit: 01.11.2022 bis 31.10.2025
Projektleitung: Prof. Thorsten Schäfer
Bearbeitung: Marcus Böhm, Anna Kogiomtzidis
Schlagworte: Boden, Rhizosphäre, Wurzelexsudate, Radionuklide, natürliche Nanopartikel, Pflanzenaufnahme
Beschreibung:
Das übergeordnete Ziel des Verbundvorhabens TRAVARIS ist es, die Ergebnisse der Forschung zum Transport und Transfer von Radionukliden im System Boden-Pflanze unter dem Aspekt der Anreicherungs- und Remobilisierungsprozesse auf der Mikroebene in die praktische Anwendung in makroskaligen radioökologischen Modellen der Biosphäre zu überführen.
-
WTZ Granit
 3D Scan (XRM) eines Bohrkerns mit farbkodierter Segmentierung der verschiedenen Mineralgruppen sowie des Porenraums (weiß)
3D Scan (XRM) eines Bohrkerns mit farbkodierter Segmentierung der verschiedenen Mineralgruppen sowie des Porenraums (weiß)Vorhersage der heterogenen Radionuklidsorption auf Kluft- und Störungsflächen in granitischen Gesteinen: Parametrisierung und Validierung verbesserter reaktiver Transportprozesse
BMWK Förderkennzeichen: 02 E 11911B
Laufzeit: 01.05.2021 bis 30.04.2024
Projektleitung: Prof. Thorsten Schäfer
Bearbeitung: Annemie Kusturica, Dr. Sarah Hupfer, Dr. Neele van Laaten
Schlagworte: Granitoide Gesteine, Spurelemente und REE Sorption, Kluftgeometrie, Reaktiver Transport
Beschreibung:
Geologische Tiefenlager sind eine international anerkannte Lösung für die langfristige sichere Endlagerung hochradioaktiver Abfälle. Ein potenzielles Wirtsgestein sind kristalline Gesteine wie Granite oder Gneise. Die Sicherheitsanalyse und Optimierung des Konzepts zur Endlagerung hochradioaktiver und langlebiger Abfälle in Granitoidformationen ist Bestandteil aktueller Forschungsvorhaben.
-
BEACON
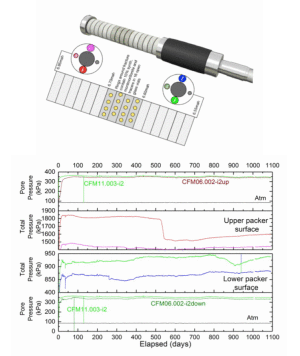 Abbildung 1: Schematische Abbildung des über 1100 Tage laufenden CFM LIT (Long-Term In Situ) Tests mit unterschiedlichen Quelldrücken im oberen (1400-1850 kPa) und unteren Bereich (850-950 kPa) des Packers und einer spontanen Druckentlastung (Homogenisierung?) von ca. 300 kPa nach ca. 500 Tagen im oberen Bereich.
Abbildung 1: Schematische Abbildung des über 1100 Tage laufenden CFM LIT (Long-Term In Situ) Tests mit unterschiedlichen Quelldrücken im oberen (1400-1850 kPa) und unteren Bereich (850-950 kPa) des Packers und einer spontanen Druckentlastung (Homogenisierung?) von ca. 300 kPa nach ca. 500 Tagen im oberen Bereich.Mechanische Entwicklung des kompaktierten Bentonits (BEACON)
Förderstelle + -kennzeichen: 745942
Laufzeit: 01.06.2017 – 31.05.2022
Projektleitung: Prof. Thorsten Schäfer
Bearbeitung: Janis Pingel, Franz Rinderknecht (KIT-INE)
Schlagworte: CFM-LIT, Bentonit, Barriere, Homogenisierung, Wassersättigung
Beschreibung: Das Hauptziel des Projektes ist es, die Werkzeuge zu entwickeln und zu testen, die für die Beurteilung der mechanischen Entwicklung einer installierten Bentonit- Barriere und der daraus resultierenden Leistungsfähigkeit der Barriere notwendig sind.
-
Eifelvulkanismus während des Weichsel-Hochglazials
Eifelvulkanismus während des Weichsel-Hochglazials
Bearbeitung:
Dipl. Thomas LangeBeschreibung:
Die Eifel ist durch ihre Vielzahl an Maaren und Schlackenvulkanen eine morphologisch außergewöhnliche Region innerhalb Deutschlands. In diesem Projekt liegt der Fokus auf den spätquartären Eifelvulkanismus in der Region Gillenfeld und Strohn. Die Entstehung des Wartgesberg-Vulkankomplexes vor knapp34 ka und die Förderung zweier Lavaströme sorgten hier zur vollständigen Talabriegelung. Die daraus resultierende Bildung glazigener Archive und die Konservierung der damaligen Landoberfläche ermögliche heute einzigartige Einblicke in die Talentwicklung der Eifel während der letzten großen Eiszeit. Blick in den nahezu vollständig abgebauten Wartgesberg-Vulkankomplex. Vor knapp 34 ka bildeten sich nahezu zeitgleich mehrere Eruptionszentren an der Ostflanke des Alfbachtals. Die geförderten Schlacken, Agglutinate und Laven türmten sich zu einer bis zu 80 m hohen Barriere auf und führten die vollständige Abriegelung des Tals herbei
Blick in den nahezu vollständig abgebauten Wartgesberg-Vulkankomplex. Vor knapp 34 ka bildeten sich nahezu zeitgleich mehrere Eruptionszentren an der Ostflanke des Alfbachtals. Die geförderten Schlacken, Agglutinate und Laven türmten sich zu einer bis zu 80 m hohen Barriere auf und führten die vollständige Abriegelung des Tals herbei -
Feinstaubquellen in urbanen Räumen Mitteldeutschlands
Bearbeitung:
Dr. Neele van Laaten , Dr. Dirk Merten, Dr. Michael PirrungBeschreibung:
Mit Hilfe von Spinnweben, Moossäckchen (sog. Moss Bags) und einfachen Passivsammlern wird Feinstaub aus anthropgenen und geogenen Quellen im mitteldeutschen Raum (mit Fokus auf die Stadt Jena) beprobt.
-
KOBIOGEO
Kontrolle biologischer Untersuchungen bei der Dekontamination heterogener, schwach radioaktiv kontaminierter Geosubstrate für die Strahlenschutzvorsorge (KOBIOGEO)
Projekt: https://www.tib.eu/de/suchen/id/TIBKAT:609340255/
Projektleitung:
Prof. Dr. Georg Büchel, Dr. Dirk MertenBeschreibung:
Schwach radioaktive, heterogene Geosubstrate können durch Phytoremediation biologisch dekontaminiert werden, so dass ein Beitrag zur Strahlenvorsorge geleistet wird. Durch Identifizierung der für die Phytoremediation relevanten Prozesse im Labormaßstab mit der innovativen Methode der Seltenen Erden Element (SEE)-Fraktionierung und der Übertragung auf natürliche Bedingungen wird eine Effizienzsteigerung gegenüber bisherigen, empirischen Ansätzen und Erfahrungen der Dekontamination schwach radioaktiver Geosubstrate erreicht. Es werden die natürlich vorkommenden Seltenen Erden Elemente und ihre Verteilung zur Prozesskontrolle und Optimierung bei der Aufnahme von Schwermetallen/Radionukliden aus geogenen Materialien in Pflanzenmaterial genutzt. Damit besteht die Möglichkeit, durch unterschiedliche Fraktionierungsmuster der SEE biologische und/oder physikalisch/chemische Prozesse zu identifizieren, welche bei der selektiven Aufnahme von Radionukliden und Schwermetallen auftreten. Somit kann auf wirksame Transportprozesse beim Transfer zurück geschlossen werden. Über die Identifizierung sowie Kontrolle hinaus lässt sich eine Optimierung der biologischen Dekontaminationsverfahren erreichen.Laufzeit:
01.10.2004 bis 31.10.2008Förderkennzeichen:
02S8294 -
KOLLORADO-e2
KOLLORADO-e2 (Integrität der Bentonitbarriere zur Rückhaltung von Radionukliden in kristallinen Wirtsgesteinen – Experimente und Modellierung)
Bearbeitung: Thorsten Schäfer (FSU) & Francesca Quinto, Madeleine Stoll, Franz Rinderknecht (alle KIT-INE)
Beschreibung:
Der Kenntnisstand zur Kolloidproblematik, speziell zur Prognostizierbarkeit des Kolloidquellterms, der Kolloidstabilität und Kolloid- Mineraloberflächen- Wechselwirkung unter Einbezug der Oberflächenrauigkeit hat in den letzten Jahren sehr große Fortschritte gemacht. Neben der Beschreibung der Kolloidstabilität mittels elektrostatischer Ansätze sind quantitative Daten zur Erosion der Bentonitbarriere in Laborversuchen generiert worden. Alle Daten zum kolloidgetragenen Radionuklidtransport weisen auf eine starke Abhängigkeit der Kolloidmobilität von der Kluftgeometrie/Oberflächenrauigkeit hin, wobei die vollständige Dissoziation vierwertige Actinide von der Tonkolloidoberfläche nach wie vor eine offene Fragestellung ist. Hauptziel des Anschlußvorhabens ist es weiterhin, das mechanistische Verständnis der Erosion des kompaktierten Bentonits und der Radionuklid-Kolloid Wechselwirkungen unter naturnahen Bedingungen mittels in-situ Experimenten zu verbessern und die Relevanz des kolloidgetragenen Radionuklidtransports hinsichtlich der Langzeitsicherheit eines Endlagers in einer Hartgesteinsformation zu bewerten. Darüber hinaus werden generische Aussagen zur Kolloidrelevanz und der Mobilität von Radionukliden erarbeitet.Förderung:
The KOLLORADO-e2 project is a joint project between KIT and GRS and is financed by the BMWi under project number 02E11456A. -
KOLLORADO-e3
 Abb. 1: Bilder des überbohrtes LIT-Experiment: (oben) Segmentierte Kluftgeometrie zur Abschätzung der Ausdehnung der Bentonit-Gelschicht in der Scherzone (erstellt von Dr. Hinz, Math2Market mittels Volume Rendering in GeoDict), (unten) überbohrte Grimsel Granodiorit Matrix (ca. 6m) bis zur Kontaktzone der Scherzone.
Abb. 1: Bilder des überbohrtes LIT-Experiment: (oben) Segmentierte Kluftgeometrie zur Abschätzung der Ausdehnung der Bentonit-Gelschicht in der Scherzone (erstellt von Dr. Hinz, Math2Market mittels Volume Rendering in GeoDict), (unten) überbohrte Grimsel Granodiorit Matrix (ca. 6m) bis zur Kontaktzone der Scherzone.In-situ Experimente zur Bentonit Langzeit-Stabilität und der Radionuklidmobilität an der Grenzfläche Bentonit - Kristallin(KOLLORADO-e3)
Förderstelle + kennzeichen: 02E11759A
Laufzeit: 01.05.2019 – 31.12.2022
Projektleitung: Prof. Thorsten Schäfer
Bearbeitung: Janis Pingel
Schlagworte: Bentonit, Multi-Barriere-System, Na-Montmorillonit, akzessorische Minerale, Erosion, Kolloide, CFM-iBET, CFM-LIT
Beschreibung:
Das übergeordnete Ziel des Vorhabens ist es, das mechanistische Verständnis der Prozesse weiter zu vertiefen, die unter naturnahen, endlagerrelevanten Bedingungen in geklüfteten Granitsystemen die Integrität der Bentonitbarriere beeinträchtigen und zu einem kolloidgetragenen Radionuklidtransport führen können.
-
TransAqua
Durch Gesteins-/Wasser-Interaktionen im Untergrund werden u.a. Radionuklide freigesetzt und gelangen von dort bis in das Trink- und Oberflächenwasser. Über die Rolle von Mikroorganismen bei diesen Freisetzungs- und Transportprozessen ist wenig bekannt.
-
TRANS-LARA
Transport und Transfer langlebiger Radionuklide entlang der kausalen Kette Grundwasser-Boden-Pflanze unter Berücksichtigung langzeitlicher klimatischer Änderungen
Förderstelle + kennzeichen: BMBF-02NUK051A-E
Laufzeit: 01.07.2019 bis 30.06.2022
Projektleitung: Prof. Dr. T. Schäfer
Bearbeitung: Marcus Böhm, Dr. Daniel Jara Heredia
Schlagworte: Radionuklide, Lysimeter, natürliche nanopartikuläre Phasen, reaktiver Transport
Beschreibung:
Für Langzeitsicherheitsnachweise potentieller Endlager gehen die gängigen radioökologischen Modelle in Störfallszenarien von einem Radionuklideintrag in die Biosphäre über den Wasserpfad aus. Neben dem Weg über Niederschlag und Bewässerung ist besonders der Eintrag über das oberflächennahe Grundwasser in den Boden interessant. Das Ziel ist es ein tieferes Verständnis über die komplexen Mechanismen des Radionuklidtransportes vom Grundwasser in Pflanzen unter dem Aspekt von klimatischen Schwankungen zu generieren. Dies soll zu einer verbesserten Gefahrenabschätzung der Strahlenexposition von Populationen über längere Zeiträume beitragen. Ein weiterer Schritt ist die Aufklärung der Aufnahmemechanismen von Radionukliden in landwirtschaftliche Nutzpflanzen auf molekularer Ebene, ein Konzept, was zu einem erweiterten Verständnis über bestehende Transferfaktoren hinausführt.
-
USER
Umsetzung von Schwermetall-Landfarming zur nachhaltigen Landschaftsgestaltung und Gewinnung erneuerbarer Energien auf radionuklidbelasteten Flächen (USER)
Projektleiter:
Prof. Dr. E. Kothe, Prof. Dr. G. BüchelLaufzeit:
01.12.2014 bis 30.11.2018Beschreibung:
Im aktuellen Projektvorhaben sollen im Rahmen des FuE-Programms „Rückbau kerntechnischer Anlagen“ im Sinne einer Strahlenschutz-Vorsorge schwermetall- und radionuklidbelastete Substrate durch die Verwendung von Bioremediationsmethoden saniert und einer Nutzung zur Produktion von Energiepflanzen zugeführt werden. Dabei zielt das Projekt auf die Nutzung einer kostengünstigen, durch Mikrobiologie gesteuerten Phytosanierung, in der belastete Substrate über eine Durchmischung mit unbelastetem Boden konditioniert und kontaminierte Flächen neu konturiert werden können. Damit können kontaminierte Flächen genutzt werden, um erneuerbare Energien (Holz als Energieträger) zu produzieren, und parallel zur Sanierung zusätzlich Wertschöpfungspotentiale erschlossen werden.Förderkennzeichen:
15S9194Abschlussbericht:
-
USER II
 Abb.1: LaserScanning-Aufnahmen (Drohne) vom Testfeld Gessenwiese (Ronneburg) zur Ermittlung der Baumhöhe von Birke, Erle, Weide auf unterschiedlich behandelten Substraten (rot=hohe Bäume; grün=niedriger Baumbestand); oben - Baumhöhe + Geländeoberfläche; Mitte1 - Baumhöhen; Mitte2 – Geländeoberfläche; unten – Aufsicht (Stand 09/2019)
Abb.1: LaserScanning-Aufnahmen (Drohne) vom Testfeld Gessenwiese (Ronneburg) zur Ermittlung der Baumhöhe von Birke, Erle, Weide auf unterschiedlich behandelten Substraten (rot=hohe Bäume; grün=niedriger Baumbestand); oben - Baumhöhe + Geländeoberfläche; Mitte1 - Baumhöhen; Mitte2 – Geländeoberfläche; unten – Aufsicht (Stand 09/2019)Umsetzung von Schwermetall-Landfarming zur nachhaltigen Landschaftsgestaltung und Gewinnung erneuerbarer Energien auf radionuklidbelasteten Flächen: Optimierungsstrategien (USER II)
BMBF-Förderkonzept FORKA 15S9417
Laufzeit: 01.07.2019 bis 30.12.2022
Projektleitung:
Prof. Erika Kothe, Prof. Thorsten SchäferBearbeitung: Dr. Daniel Mirgorodsky, Sarah Nettemann, K. Lenk, D. Fürst, S. Pietschmann
Beschreibung:
Nach einer ersten Etablierungsphase (USER) wird im Verlauf des Projektes die Möglichkeit einer mikrobiell gestützten Phytostabilisierung zur Erzeugung von Lignozellulose als nachwachsendem Rohstoff auf mit Schwermetallen und Radionukliden (SM/R) belastetem Substrat aus einem ehemaligen Uranbergbau etabliert.









